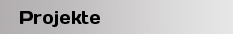Ein Pionier des Obst- und Gartenbaues im 19. Jahrhundert
von Franz Just

Eduard Lucas
Geboren 1816 in Erfurt, erlernte Lucas den Beruf eines Gärtners in den berühmten Gartenanlagen der Fürsten von Anhalt-Dessau zwischen Dessau und Wörlitz. Seine Gehilfenzeit führte ihn in den Jahren 1834–38 über Frankfurt/Oder nach Greifswald und schließlich nach München, wo er in den beiden Folgejahren im Botanischen Garten den sogenannten „Kleinen Garten" betreute. Seine Vorgesetzten, Karl Friedrich Philipp Martius und Josef Gerhard Zuccarini, beides berühmte Professoren der Botanik an der Universität München, waren auf den jungen Gehilfen wegen seines Fleißes und Eifers, vor allem aber auch wegen seiner neuartigen Kultivierungsmethoden aufmerksam geworden. Sie ermöglichten ihm die Teilnahme an Vorlesungen und Exkursionen, wodurch er die wissenschaftlichen Defizite in der damaligen Gärtnerausbildung ausgleichen konnte. Einer besonderen Gunstbezeugung verdankte es Lucas, daß ihm durch Vermittlung von Martius Ende 1840 die gärtnerische Leitung des Botanischen Gartens der ‘Königlich Botanischen Gesellschaft' von Regensburg übertragen wurde.
Seine fast dreijährige Tätigkeit in Regensburg endete, nachdem Lucas sich im September 1842 auf die im ‘Schwäbischen Merkur' ausgeschriebene Stelle eines Institutsgärtners an der 1818 gegründeten ‘Landwirtschaftlichen Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt' und späteren Akademie in Stuttgart-Hohenheim beworben hatte und unter zwölf Bewerbern im März 1843 ausgewählt wurde. Als Gärtner in Hohenheim fielen ihm neue, ungewohnte Aufgaben zu, so die Betreuung ausgedehnter Obstbaumpflanzungen und Baumschulen, wie auch die Unterrichtung von Schülern in Theorie und Praxis von Obstbaumzucht, Gemüsebau und Kunstgärtnerei. Und da in Hohenheim bis dahin noch keine Gartenbauschule existierte, wurde er zudem mit der Einrichtung einer solchen beauftragt. Damit begann für Lucas eine 17 Jahre dauernde Zeit, zu der er in seiner Autobiographie anmerkte: „War ich früher ein eifriger Pflanzenzüchter und Vermehrer gewesen, so wurde ich nun ein nicht minder eifriger Obstbaumzüchter und gab mir namentlich Mühe, mich in die Pomologie hinein zu arbeiten." Dabei stützte er sich vor allem auf die 22 Bände von Johann Volkmar Sicklers ‘Teutschem Obstgärtner' (1803) und Johann Georg Dittrichs ‘Vollständigem Handbuch der Obstkunde' (1837). Aus den Erfahrungen, die Lucas mit diesen und anderen verfügbaren pomologischen Schriften machte, entstand ein Buch mit dem Titel ‘Die Lehre von der Obstbaumzucht auf einfache Gesetze zurückgeführt', das gleich nach seinem Erscheinen große Anerkennung in Fachkreisen fand. Es erschien in sieben Auflagen und wurde ins Russische, Polnische und Ungarische übersetzt. Eine Fortsetzung hatte es schließlich in ‘Lucas Anleitung zum Obstbau', das als der „LUCAS" dazu beitrug, daß sein Name Generationen von Obstbaumzüchtern zu einem festen Begriff wurde. Noch heute wird es – nach 140 Jahren – vom Eugen Ulmer-Verlag in der 32. Auflage herausgebracht.
1848 veröffentlichte Lucas eine weitere Schrift, die starke Beachtung fand und im Besonderen auf die Verhältnisse im Obstland Württemberg Bezug nahm: ‘Der Obstbau auf dem Lande als belehrende Instruction für Gemeindebaumwärter'. Sie war vor allem für die jungen Leute bestimmt, die nach Hohenheim kamen, um sich als Baumwärter ausbilden zu lassen. Diese Schrift wurde in Württemberg später Grundlage staatlicher Bestimmungen zur Verbesserung des Obstbaus.

Reutlingen
Für den Obstbau im traditionsreichen Obstland Württemberg erwirkte Lucas mit einer Reihe von Maßnahmen grundlegende Verbesserungen. Nach etlichen im Regierungsauftrag durchgeführten Reisen durch die Oberämter des Landes, auf denen er einen „beklagenswerten Zustand der Obstkultur" feststellen mußte, begann er 1850 mit speziellen Kursen für Baumwärter und Landwirte. Zudem erreichte er, daß Obstbaukunde zu einem wichtigen Fach an den durch König Wilhelm I. von Württemberg eingeführten Ackerbauschulen des Landes wurde. Mit Unterweisungen durch Wanderlehrer und der Einrichtung von Abendschulen in den einzelnen Gemeinden, gelang es Lucas, auch auf „einfache Landleute" Einfluß zu nehmen, da in vielen Gegenden des Landes die Zahl der Baumwärter nicht ausgereicht hätte, um sämtliche Obstbäume pflegen zu können. Die erforderlichen Anweisungen vermittelte er mit entsprechenden Schriften wie ‘Die Gemeindebaumschule – eine Dienstanweisung für Gemeindebaumschulwärter' – die übrigens auch in Norddeutschland sowie in benachbarten Ländern des Auslands Anwendung fand – oder ‘Unterhaltungen über den Obstbau' aus der Reihe ‘Des Landmanns Winterabende'.
1853 wurde Lucas der Titel eines „Königlichen Garteninspektors" verliehen. Fünf Jahre später erhielt er die „Goldene Civilverdienstmedaille" des Königreichs Württemberg.
Trotz dieser Anerkennungen verließ Eduard Lucas 1860 Hohenheim. Er schied aus dem Staatsdienst aus, um in Reutlingen eine ‘Höhere Fachschule für Pomologie und Gartenkultur, nebst deren Grund- und Hilfswissenschaften', zu gründen, der er die Bezeichnung ‘Pomologisches Institut' gab. Er entschloß sich zu diesem Schritt, weil es ihm als Staatsdiener in Hohenheim „zu eng" geworden war. In allen Entscheidungen war er von der vorgesetzten Behörde abhängig und in der Hierarchie des Lehrpersonals dominierten die Professoren, die ihn nicht selten spüren ließen, daß er nur ein „einfacher Gärtner" war. Hinzu kam, daß er die selbst als unzureichend erlebte, einseitig praktisch ausgerichtete Ausbildung junger Gärtner auf ein allgemein höheres Niveau zu bringen versuchte. Bereits 1849 hatte ihn die Not zahlreicher Gärtner – eine Folge der Märzrevolution, in der viele Gärtner ihre Stellung verloren hatten – zu einem „Aufruf an die deutschen Gärtner" veranlaßt, in dem er die Gründung höherer Fachschulen für eine bessere Ausbildung forderte. Eine entsprechende Petition, die er 1857 zusammen mit Oberdieck an mehrere deutsche Regierungen richtete, blieb ohne Erfolg.

Keller 1860
Die zum Institut gehörende Fachschule hatte ein hohes Ansehen und zog Schüler aus aller Welt an. Erstmals bot eine Schule eine praxisbetonte und zugleich wissenschaftliche Ausbildung nicht nur im Gartenbau, sondern vor allem auch im Obstbau. Um sich als Internatsschule selbst unterhalten zu können und den Schülern die Möglichkeit zum Erwerb praktischer Fertigkeiten zu geben, führte das Institut einen gärtnerischen Betrieb, in dem unter Einsatz der Arbeitskraft der Schüler die erforderlichen Einnahmen selbst erwirtschaftet wurden. So verkaufte man Jungbäume, Edelreiser, Beerenobststräucher, Stauden, Tafelobst, Gemüse, Sämereien, Gartengeräte (zum Teil aus eigener Konstruktion), Pflanzenschutzmittel, Gartenbauliteratur und unterhielt auch einen Weinkeller. Edelreiser wurden bis nach Japan und Übersee versandt. Im Verkaufsjahr 1882/83 waren es nicht weniger als 46.000 Stück.
Als erste Einrichtung ihrer Art war das Reutlinger Institut mit seiner Fachschule wegweisend und wurde zum Vorbild für etwa 50 ähnliche Ausbildungsstätten in Deutschland. Bis zur Schließung 1922, wurden in Reutlingen 3.500 Schüler ausgebildet, die, nicht selten in leitender Stellung, ihr Wissen und Können in deutschen und ausländischen Obstbaugebieten anwenden konnten.
Für den württembergischen Obstbau erwies sich die Einführung der Baumwärterkurse durch Lucas als besonders wirkungsvoll. Der Baumwart, und damit die Pflege der Obstbäume, wurde ein selbständiger, staatlich anerkannter Beruf. Damit begründete Lucas eine Tradition, die über die Anstellung von Oberamtsbaumwärtern und später von Kreisfachberatern für Obst- und Gartenbau zu einer modernen Grünflächenberatung in unserer Zeit führte.

Apfelsorten
Enttäuschungen blieben ihm indes nicht erspart. 1877, während der VIII. Jahresversammlung des ‘Deutschen Pomologenvereins' in Potsdam, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Potsdamer Garteninspektor Wilhelm Lauche, der sich schon lange für eine Reduzierung der anzubauenden Obstsorten im Verein eingesetzt hatte, um so der Verwirrung um das riesige Sortiment in Deutschland zu begegnen. Lucas hingegen setzte auf Beibehaltung der Vielfalt, mit dem Ziel, den „unendlich divergierenden Standorten" durch Empfehlung jeweils angepaßter Sorten gerecht zu werden – was allerdings eine immerwährende, genaue Bestimmung ständig neu entstehender oder aus dem Ausland eingeführter Apfel- und Birnensorten erforderlich gemacht hätte.
1877 hielten Lauche und seine Anhänger die Zeit für gekommen, Lucas als Geschäftsführer des Pomologenvereins abzulösen. Wohl um dem unsicheren Ausgang eines korrekt durchgeführten Wahlverfahrens zuvorzukommen, verlegte Lauche, der mit der Organisation der Versammlung betraut war, die Abstimmung auf einen späten Zeitpunkt des ersten Abends, nämlich auf die Zeit um Mitternacht. Als die meisten, von der Reise ermüdeten Teilnehmer, im Glauben es würden nur noch Formalitäten behandelt, die Versammlung verlassen hatten, kam es zur Wahl eines neuen Vorstands. 50 in der Versammlung noch zurückgebliebene Teilnehmer wählten mit 7 Stimmen Mehrheit Wilhelm Lauche zum neuen Vorstand und Potsdam zum neuen Vereinsmittelpunkt. Lucas war empört und weigerte sich, das Ergebnis anzuerkennen. Jahrelange Streitigkeiten und Prozesse führten daraufhin zu einem tiefen Riß im Verein. Lucas sah sich weiterhin als rechtmäßigen Vorstand bis er schließlich 1880 auf dem Pomologenkongreß in Würzburg – dem letzten, dem er beiwohnte – sein Amt als Geschäftsführer niederlegte. Zwei Jahre später starb er verbittert im Alter von 66 Jahren in Reutlingen. Friedrich Lucas übernahm nach dem Tod des Vaters die Leitung des Reutlinger Instituts und führte es erfolgreich weiter bis zu seinem eigenen Tod 1921. Ein Streit unter den Erben brachte im darauffolgenden Jahr das Ende des Familienunternehmens.
Eduard Lucas hinterließ ein literarisches Werk, das 48 Bücher umfaßte. Es bezeugt den herausragenden Wissensstand des Autors ebenso wie sein unablässiges Bemühen um eine größtmögliche Sortimentsvielfalt mit umfassender Sortenkenntnis als Grundlage eines modernen Obstbaus. Er erlebte nicht mehr, wie nach seinem Tod das Gegenteil, nämlich eine Sortenreduzierung nach dem Motto „viel Obst in wenig Sorten", zum Programm wurde und viele der alten Obstsorten in Vergessenheit gerieten.
Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Denkmals für Eduard Lucas auf dem Reutlinger Friedhof würdigte 1883 der Verleger Eugen Ulmer Lucas Lebenswerk: „Wohl selten ist einem einzelnen Mann, der sich nicht auf die Mittel und Einrichtungen des Staates, sondern nur auf seine eigenen Kräfte stützen konnte, beschieden gewesen, eine so umfangreiche und segensreiche Wirksamkeit auszuüben, wie Dr. Eduard Lucas es vermocht hat. Ihm, neben seinem vorangegangenen Mitarbeiter J.G.C. Oberdieck, haben wir es in erster Linie zu danken, daß der Obstbau, welcher bei uns in Deutschland vielerwärts der Zurücksetzung und Vernachlässigung preisgegeben war, jetzt mehr und mehr die ihm gebührende Stellung im wirtschaftlichen Leben des Volkes einzunehmen beginnt. Und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, erstreckte sich die von Lucas geübte Wirksamkeit und steht sein Name in Ansehen. So wie kaum ein Zweig der pomologischen Theorie oder Praxis vorhanden, der nicht durch ihn weitergebildet worden, so war Lucas unermüdlich tätig, sein Wissen und Können durch Wort und Schrift zum Gemeingut aller zu machen. Bei vielen Tausenden seiner mittelbaren und unmittelbaren Schüler lebt Lucas in dankbarem Andenken fort."